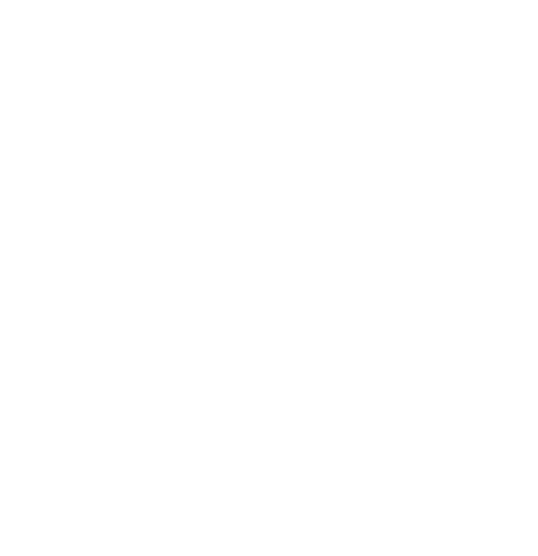Simulationsmodelle von Perturbationen des granulozytären Zellerneuerungssystems
pp. 89-106
in: Wilhelm Doerr, Heinrich Schipperges (eds), Modelle der pathologischen Physiologie, Berlin, Springer, 1987Abstract
Wenn wir von neutrophilen Granulozyten im menschlichen Blut sprechen, so denken wir an ihre Konzentration pro mm3. In den Lehrbüchern der Hämatologie sind sog. Normalwerte von 2–7 × 103 angegeben [1, 2]. Beim Hund — dem von uns vorzugsweise benutzten Versuchstier — liegen die Normalwerte im gleichen Bereich. Für unsere Erörterungen ist es wichtig, darauf hinzuweisen, daß ein solcher jederzeit nachprüfbarer Normwert nur einen Teil der Blutgranulozyten erfaßt. Mit Hilfe von Autotransfusionen von radioaktiv markierten Granulozyten gelang es zu zeigen, daß neben den zirkulierenden Granulozyten noch ein etwa gleichgroßes Kompartment an Granulozyten vorhanden ist [3, 4]. Man spricht dabei von dem "marginalen Speicher". Bei einem raschen Granulozytenanstieg, wie er bei bestimmten "Stress"-Situationen vorkommt, kommt es zunächst zu einer Verschiebung aus dem "marginalen" in den "zirkulierenden" Speicher und erst dann zu einer Mobilisation von Granulozyten aus dem Knochenmarkorgan in das Blut [1]. Diese wenigen Sätze sollen deutlich machen, daß hinter dem Normwert der Blutgranulozyten eine ungeheure Dynamik steht. Diese wird verständlich, wenn man bedenkt, daß die Lebensdauer von Granulozyten im menschlichen Blut maximal 24–30 Stunden beträgt — wie wir 1964 erstmals aufgrund von Zellmarkierungen mit 3H-Thymidin zeigen konnten [5, 6]. Man kann unschwer berechnen, daß täglich ca. 120 × 109 Granulozyten das Blut verlassen, um ihre extravasalen Aufgaben wahrzunehmen oder aus Alterungsgründen eleminiert werden. Eine gleichgroße Anzahl muß also aus den weit über 100 einzelnen Knochenmarkabschnitten kontinuierlich nachgeliefert werden. Wir sprechen von einem Fließgleichgewicht zwischen Abfluß von Granulozyten aus der Blutbahn und ihrem Einstrom in die Blutbahn (Kein = Kaus)